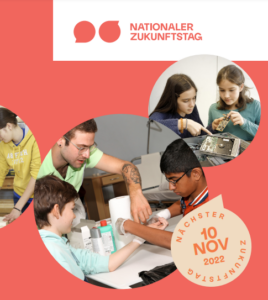Vor 20 Jahren kannte kaum einer den Begriff «Mobbing», heute ist er in aller Munde. Früher war es normal, dass Kinder einander plagen, man war der Meinung, das härte ab. Heute weiss man, dass Mobbing die Gefahr von Depressivität, Alkoholmissbrauch oder Schulabbruch erhöht. Gleichzeitig fällt das Wort «Mobbing» heute oft vorschnell und im falschen Kontext. Für die Opfer hat dies schwere Folgen, denn um sie schützen zu können, müssen die Erwachsenen wissen, was Mobbing ist und der Unterschied zu einem normalen Streit erkennen.
Was unterscheidet Streit von Mobbing?
«Mobbing bezeichnet ein gezielt aggressives Verhalten, das sich systematisch und wiederholt gegen ein bestimmtes Kind richtet, und das über mindestens mehrere Wochen hinweg» (Gutzwiller-Helfenfinger, S. 10; Das Schweizer ElternMagazin Fritz+Fränzi, Nr. 6, Juni 2020).
Doch nicht jedes aggressive Verhalten, welches wiederholt vorkommt, ist als Mobbing einzustufen. Wenn ein Kind wahllos immer wieder Mitschüler plagt, dann handelt es sich nicht um Mobbing. Mobbing ist ein Gruppenphänomen in dem ein Machtungleichgewicht besteht. Meist mobben ein paar Kinder zusammen, die von einem Anführer angeleitet werden, ein unterlegenes Kind, das kaum Chancen hat, sich alleine zu wehren. Demgegenüber stehen Konflikte oder Auseinandersetzungen zwischen ebenbürtigen Beteiligten. Von einem Streit sprechen wir, wenn sich zwei Kinder um ein Spielzeug streiten oder unter Jugendlichen eine Meinungsdifferenz entbrennt. Es geht bei Konflikten um gegensätzliche Ansichten oder Ziele, meist steht eine Sache im Vordergrund.
Streit und Konflikte sind zudem ein wichtiger Bestandteil der sozialen Entwicklung. Kinder lernen durch Konflikte und Streitereien Lösungen auszuhandeln, Kompromisse einzugehen und andere Meinungen zu respektieren. Bei Mobbing fehlt der Lernprozess. Mobbing beeinträchtigt die gesunde Entwicklung. Opfer von Mobbing leiden häufig unter Angstzuständen, depressiven Stimmungen oder Suizidalität. Forscher stellten aber auch fest, dass auch Täter ein erhöhtes Risiko für späteren Drogenmissbrauch und Gesetzesbruch haben. Und leider betreffen solche Folgen oft nicht nur Opfer und Täter, sondern auch unbeteiligte Zeugen des Geschehens.
Man unterscheidet bei Mobbing zudem zwischen direktem und indirektem Mobbing. Bei direktem Mobbing wird das Opfer geschlagen, beschimpft oder mutwillig Sachen beschädigt. Es wird klar deutlich wer wen fertigmacht. Schwieriger zu erkennen ist ein indirektes Mobbing, bei dem Täter offene Konfrontationen vermeiden, kaum sichtbar die Augen verdrehen, sobald das Opfer etwas sagt, vermeintlich ausversehen dem Opfer das Bein stellen, es aus der Gruppe ausschliessen oder Gerüchte verbreiten. Werden die Täter mit solchen Situationen konfrontiert, können die Täter die Handlungen gut zu ihren Gunsten drehen. So wird zum Beispiel ein böses Gerücht als Witz abgetan oder grobes Anrempeln als Versehen dargestellt.
Deshalb ist es auch wichtig scheinbar harmlose Konflikte ernst zu nehmen, wenn sie immer dasselbe Kind betreffen. Wichtig ist dabei nicht zu vergessen, dass es bei Mobbing um eine Gewaltform handelt, die normalerwiese in der Gruppe entsteht und von der Gruppe aufrechtgehalten und auch vertuscht wird. Mobbing betrifft immer eine ganze Gruppe oder Klasse, denn jedes Kind nimmt im Geschehen eine Rolle ein: Opfer, Täter, Mitläufer, Verstärker, die einfach zuschauen und lachen, und die indirekt Beteiligten welche als Zeugen passiv zuschauen oder das Weite suchen, aus Angst selbst zum Opfer zu werden. Weiter gibt es auch die Rolle der Helfer, die sich für das Opfer einsetzen, dies allerdings sehr selten.
Mobbing ist sehr schwer zu stoppen. Die Beteiligten sind in ihren Rollen oft eingefahren. Der Täter fühlt sich durch die Rückmeldungen der Mitläufer stark, gleichzeitig erwartet die Gruppe Unterhaltung. Gleichzeitig haben die Schweigenden Angst, selbst Opfer zu werden und sind oft überfordert mit der Situation und wissen keine Wege das Problem zu lösen ohne sich selbst auszustellen.
Was können Eltern bei Mobbingverdacht tun?
Typisch für alle Mobbingformen ist das Schweigen der Beteiligten. Mobber verheimlichen ihre Taten gegenüber Erwachsene und auch Opfer schweigen aus Angst nicht ernstgenommen oder als Petze hingestellt zu werden. Deshalb ist es wichtig wachsam zu sein und mögliche Wahrnsignale als solche zu erkennen. Es gibt allerdings keine Symptome die ausschliesslich auf Mobbing zurückzuführen sind, trotzdem ist es wichtig auf Signale zu achten. Solche Warnsignale sind:
- häufiges Klagen über Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Appetitlosigkeit
- Schlafstörungen
- Nachlassende Schulleistungen
- Ängstlichkeit und zunehmender Rückzug
- Verletzungen, blaue Flecken
- Zerstreutheit und fehlende Konzentration
- Abwertende Bemerkungen über sich selbst
- Häufiges verlieren oder beschädigen von Gegenständen
Machen Sie sich Sorgen, dass etwas nicht stimmt, ist es wichtig das Gespräch mit dem Kind zu suchen. Am besten ist es, das Kind auf den Verdacht anzusprechen, z.B.: «Ich stelle fest, dass du dich in letzter Zeit zurückziehst und kaum mehr isst. Ich habe das Gefühl, dass dich etwas bedrückt. Ich möchte mit dir darüber reden». Wenn das Kind das Gespräch abwehrt, sollten Eltern aber auch kein Druck aufsetzen und das Gespräch bei einer anderen Gelegenheit nochmals suchen. Erzählt das Kind, ist es wichtig einfach nur zu zuhören und Ratschläge zu verzichten, insbesondere das Kind soll sich wehren. Mobbingopfer haben sich meist schon gewehrt, allerdings erfolglos. Solche Aussagen führen nur dazu, dass sich das Kind schuldig fühlt, es bekommt das Gefühl es werde gemobbt, weil es sich nicht wehrt. Hören Sie ihrem Kind einfach nur zu und stellen Sie Fragen: Wann hat es angefangen? Wie viele sind auf der anderen Seite? Gibt es Kinder die sich solidarisieren mit dem Opfer? Wichtig ist, hier auch wieder nur zuzuhören und keine Massnahmen anzudrohen und auch die Situation nicht zu dramatisieren. Wichtiger ist es gemeinsam zu besprechen, welche Handlungsmöglichkeiten für das Kind akzeptierbar wären. Nach dem Gespräch mit dem Kind, sollte die Lehrperson informiert und deren Einschätzung eingeholt werden. Anschuldigungen gegenüber Kinder und Schule sind nicht zielführend. Wichtig ist, dass die Situationen und die Beobachtungen genau beschrieben werden und mit der Lehrperson, im besten Fall auch mit der Schulsozialarbeit, weitere Schritte genau besprochen werden. Vermeiden Sie Feuerwehrübungen und zu schnelle Reaktionen. Wir Schulsozialarbeiter haben das Wissen und die Mittel Mobbing mit der Klasse zu bearbeiten, aufzubrechen und Wege das Opfer zu schützen. Mobbing ist nicht in einem Tag gelöst, es braucht Zeit und vor allem viel Vertrauen und Kooperation zwischen Schule und Eltern.
Schulsozialarbeit Primarschule Niederhasli